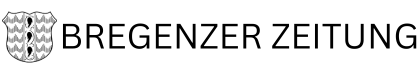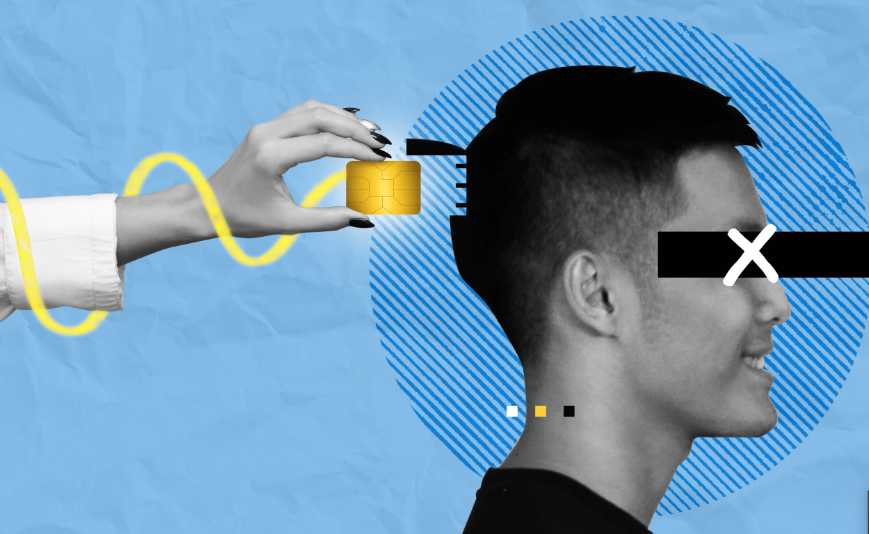Was wie Science-Fiction klingt – Gedanken, die in digitale Befehle umgewandelt werden – ist für den 30-Jährigen aus Arizona Realität geworden. Im Januar 2024 erhielt Noland das Neuralink-Implantat, das ihm die Kontrolle über einen Computer nur mit seinen Gedanken ermöglichte. Acht Jahre nach einem schweren Tauchunfall, der ihn vom Hals abwärts gelähmt hatte, wurde diese Technologie zur Hoffnung für die Zukunft.
Neuralink und die Chance auf mehr Selbstständigkeit
Noland Arbaugh verlor durch einen Tauchunfall im Jahr 2016 die Fähigkeit, sich selbstständig zu bewegen. „Man verliert die Kontrolle über alles, sogar über die Privatsphäre“, erklärte er. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sich entschloss, am Neuralink-Experiment teilzunehmen, zweifelte er daran, jemals wieder die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. Das implantierte Gerät – ein sogenanntes Brain-Computer-Interface (BCI) – ermöglichte es ihm, einen Computer nur mit seinen Gedanken zu bedienen.
Neuralink, das von Elon Musk gegründete Unternehmen, hat durch seine Forschung zur Entwicklung dieser Technologie viel Aufmerksamkeit erregt. Auch wenn Musk oft im Fokus steht, betont Noland: „Für mich ist Neuralink kein Elon-Musk-Gerät.“ Es sei der wissenschaftliche Fortschritt, der für ihn im Mittelpunkt steht. Auch Musk äußerte sich vorsichtig und berichtete von „guten ersten Ergebnissen“ bei der neuronalen Aktivität.
Die Technik hinter Neuralink: Gedanken werden zu Befehlen
Das Prinzip hinter der Neuralink-Technologie ist einfach, aber revolutionär. Das Implantat registriert elektrische Impulse im Gehirn, die beim Nachdenken an Bewegungen entstehen. Diese Impulse werden in digitale Befehle übersetzt, etwa das Bewegen eines Mauszeigers auf einem Bildschirm. Forscher arbeiten seit Jahrzehnten an solchen Technologien, aber erst durch Musk’s Engagement und die damit verbundenen Investitionen rückte sie ins Rampenlicht.
Mit Gedanken spielen – Nolands erste Erlebnisse
Nach der Operation konnte Noland bereits einen Cursor mit seinen Gedanken bewegen. „Es war zu fantastisch, um wahr zu sein“, sagte er. Als er auf dem Bildschirm seine Neuronen aktiv werden sah, wurde ihm klar, dass er den Computer tatsächlich mit seinem Geist steuern konnte. „Ich konnte nicht glauben, dass es wirklich funktioniert“, fügte er hinzu.
Die Kontrolle über das Gerät verbesserte sich nach und nach. Heute ist Noland nicht nur in der Lage, alltägliche Aufgaben zu erledigen, sondern spielt auch wieder Videospiele und Schach – Aktivitäten, die er nach seinem Unfall aufgegeben hatte. „Ich schlage jetzt meine Freunde – das war eigentlich unmöglich“, so Noland.
Risiken und ethische Fragen der Technologie
Doch die Technologie bringt auch Herausforderungen mit sich. Anil Seth, Professor für Neurowissenschaften, warnt vor dem möglichen Verlust der Privatsphäre. „Wer Gehirnaktivität überträgt, gibt nicht nur Handlungen, sondern auch Gedanken und Gefühle preis“, erklärte er. Noland selbst sieht diese Gefahr nicht so dramatisch und träumt bereits davon, eines Tages auch seinen Rollstuhl oder einen Roboter mit seinen Gedanken zu steuern.
Technische Schwierigkeiten und die Grenzen der Technik
Trotz des beeindruckenden Fortschritts gab es auch technische Schwierigkeiten. Einmal verlor Noland kurzfristig die Kontrolle über den Computer, als das Implantat vom Gehirn getrennt wurde. „Es war extrem frustrierend“, sagte Noland. Doch Ingenieure konnten den Fehler mit einer Softwareanpassung beheben. Der Vorfall zeigte, dass die Technologie zwar viel Potenzial hat, aber auch noch nicht ausgereift ist.
Weltweite Entwicklungen im Bereich der Gehirn-Interfaces
Neuralink ist nicht das einzige Unternehmen, das an Gehirn-Interfaces arbeitet. Auch Synchron, ein weiteres Unternehmen in diesem Bereich, verfolgt einen anderen Ansatz. Ihr Gerät, der sogenannte „Stentrode“, wird über eine Halsvene ins Gehirn eingeführt, ohne dass der Schädel geöffnet werden muss. „Das Gerät erkennt, ob jemand an das Tippen denkt und wandelt diese Gedanken in digitale Signale um“, erklärte Riki Bannerjee, Technikchef bei Synchron.
Einige Patienten haben bereits von dieser Technologie profitiert. Einer von ihnen, der anonym bleiben möchte, nutzt das Gerät in Kombination mit der Apple Vision Pro, um virtuell durch Australien und Neuseeland zu reisen.
Ein Blick in die Zukunft der Neurotechnologie
Noland Arbaugh nimmt derzeit an einer sechsjährigen Studie teil, die die Auswirkungen von Neuralink weiter untersuchen soll. Auch wenn er die Technologie als vielversprechend ansieht, warnt er davor, sie zu früh zu glorifizieren. „Wir wissen noch so wenig über das Gehirn. Aber diese Technik eröffnet uns völlig neue Einblicke“, sagte er.
Die Zukunft der Neurotechnologie
Die Neuralink-Technologie hat das Leben von Noland Arbaugh grundlegend verändert. Sie zeigt das enorme Potenzial, Menschen mit schwerer körperlicher Behinderung mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen. Doch es gibt noch viele Fragen und Herausforderungen, die es zu beantworten gilt. Noland hofft, dass die Technologie weiterhin Fortschritte macht und irgendwann auch anderen Menschen mit ähnlichen Einschränkungen hilft.