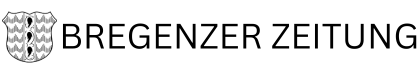Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde im Mai 2025 in zweiter Instanz rechtskräftig freigesprochen. Die Justiz sprach ihn von allen Vorwürfen frei. Dennoch sorgt seine öffentliche Reaktion für Aufsehen. In einem Interview mit der „Kronen Zeitung“ sprach er von einem „systemischen Problem“ in der Justiz. Ermittlungen seien „viel zu lange, viel zu oft, viel zu intensiv“ geführt worden – obwohl sie aus seiner Sicht von Beginn an haltlos waren.
Der Freispruch zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert. Doch Kurz’ Aussagen werfen Fragen auf. Ein ehemaliger Kanzler, der das Vertrauen in die Justiz öffentlich infrage stellt, bewegt sich auf dünnem Eis. Denn wer die Unabhängigkeit der Gerichte kritisiert, stellt sich nicht nur gegen einzelne Verfahren, sondern gegen eine zentrale Säule der Demokratie.
Sebastian Kurz war einst der Shootingstar der österreichischen Politik. Mit 23 Jahren Staatssekretär, mit 31 Bundeskanzler – ein rasanter Aufstieg, der in Europa für Schlagzeilen sorgte. Viele sahen in ihm einen Hoffnungsträger für eine moderne, pragmatische Politik. Doch der Glanz verblasste schnell. Seine Zeit an der Spitze war geprägt von strategischer Kommunikation, starker Kontrolle der Medienbotschaften und politischen Machtspielen. Auch im Parlament blieb er oft vage. Seine Aussagen im Untersuchungsausschuss wirkten ausweichend und wenig konkret.
Heute wirkt vieles davon wie ein Muster. Sebastian Kurz hat früh gelernt, wie man öffentlich wirkt. Doch Transparenz, Klarheit und Verantwortung schienen dabei oft in den Hintergrund zu treten. Der aktuelle Freispruch hätte eine Gelegenheit sein können, die politische Vergangenheit selbstkritisch zu reflektieren. Stattdessen nutzt Kurz den Moment für scharfe Kritik an Institutionen.
Diese Haltung trifft auf gemischte Reaktionen. Einige Unterstützer sehen in Kurz weiterhin einen ungerecht Behandelten. Andere verweisen auf seine Regierungszeit. Seine Migrationspolitik war stark rhetorisch geprägt, konkrete Erfolge blieben überschaubar. Auch wirtschaftlich entwickelte sich Österreich unter seinen Nachfolgern – die er maßgeblich mitbestimmte – negativ. Das Land rangiert heute bei Wachstum und Beschäftigung am unteren Ende der EU-Ranglisten. Viele Experten sehen darin ein strukturelles Erbe seiner Politik.
Sein öffentliches Auftreten ist geblieben. Auf Instagram zeigt sich Kurz regelmäßig – bei Reisen, privaten Momenten, mit internationalen Persönlichkeiten wie Jared Kushner. Die Mischung aus Politik, Lifestyle und Personenkult polarisiert. Während andere Ex-Kanzler sich zurückziehen oder beratende Rollen übernehmen, sucht Kurz weiterhin die Bühne.
Ob er in die Politik zurückkehrt, ist offen. Beobachter halten es für möglich. In der Vergangenheit hat er betont, sich ein Comeback vorstellen zu können. Die Frage ist jedoch nicht nur, ob er es will – sondern ob Österreich das braucht. Denn das Land steht vor großen Aufgaben: wirtschaftlich, sozial, politisch. Dafür braucht es Vertrauen in die Institutionen und einen sachlichen, verantwortungsbewussten Umgang mit Macht und öffentlicher Debatte.
Auch international hat sich Kurz in den letzten Jahren klar positioniert. Seine Nähe zu Politikern wie Viktor Orbán, Benjamin Netanjahu oder Donald Trump hat ihm Kritik eingebracht. Gleichzeitig pflegt er enge Beziehungen zu autoritären Regimen im arabischen Raum. Dieser außenpolitische Kurs wirft Fragen auf – gerade in Zeiten, in denen Europa nach klaren demokratischen Werten sucht.
Am Ende bleibt ein ambivalentes Bild: Ein eloquenter Kommunikator, der politisch polarisierte. Ein Freigesprochener, der sich als Opfer inszeniert. Und ein Ex-Kanzler, der noch immer nicht ganz losgelassen hat. Der Freispruch ändert daran wenig – aber er beendet ein Kapitel. Die Frage ist, welches nun folgt.